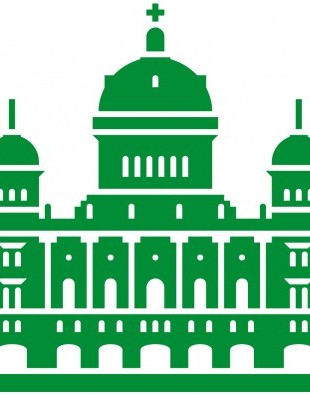«Im mittleren Lebensabschnitt passiert bei vielen Menschen sehr viel, aber dem wird kaum Beachtung geschenkt, weil Probleme wie Burnout oder gescheiterte Beziehungen stark tabuisiert sind.»
Sep. 2016Lebensphasen
Interview mit Pasqualina Perrig-Chiello. Die Professorin für Entwicklungspsychologie forscht an der Universität Bern, namentlich zu den Themen des mittleren und höheren Lebensalters und zu Generationenbeziehungen. Im «spectra»-Gespräch umreisst Pasqualina Perrig-Chiello die Entstehung von Persönlichkeit und Lebensstil, die Rolle von biografischen Brüchen und Krisen und deren Einfluss auf die Gesundheit.
spectra: Lange investierte man in der Prävention vor allem in die junge Generation, weil man davon ausging, dass Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter erlernt werde. Wie sieht dies heute aus?
Pasqualina Perrig-Chiello: Persönlichkeit und Lebensstil bilden sich in den ersten zwanzig, dreissig Lebensjahren aus und sind danach recht robust verankert. Deshalb hat man sich in der Prävention lange Zeit auf die ersten Lebensphasen konzentriert. Das ist auch richtig so, denn ein guter Start ins Leben ist immer noch immens wichtig. Es fehlte aber lang an Wissen um den Lebensverlauf, um zu erkennen, dass für Prävention und Gesundheitsförderung auch spätere Lebensphasen relevant sind. Die ersten Langzeitstudien über das Altern wurden erst in den 1960er- und 1970er-Jahren gestartet. Von diesen Studien zehren wir noch heute. Sie zeigten, dass menschliches Verhalten bis ins hohe Alter veränderbar ist, wenn auch nicht mehr so leicht wie in jungen Jahren, wegen der besagten Robustheit der Lebensstile.
Unsere Gesprächspartnerin
Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Jahrgang 1952, ist Professorin am Institut für Psychologie der Universität Bern und Leiterin verschiedener Forschungs-projekte zu den einzelnen Lebensaltern. Schwerpunkte ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit sind Entwicklungs-psychologie der Lebensspanne, Generationenbeziehungen sowie Wohlbefinden und Gesundheit. Sie lebt in Basel, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.
Warum sind Lebensstile so robust?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gewohnheiten und eigene Rhythmen geben uns Sicherheit und vereinfachen das Leben. Ab dreissig fangen sich die Lebensstile an zu verfestigen, die sich später in der Regel nicht wesentlich verändern. Wer mit dreissig zum Beispiel eine offene, kommunikative Persönlichkeitsstruktur hat, wird diese mit grosser Wahrscheinlichkeit mit achtzig immer noch haben.
Wie kommt der Lebensstil eines Menschen zustande?
Es sind verschiedene Faktoren im Spiel. Für die Entwicklung eines gesunden Lebensstils ist wie für vieles andere – neben der Persönlichkeit – die Bildung ein entscheidender Faktor. Weiter spielen der elterliche Erziehungsstil, sowie die Bezugsgruppen (Partnerschaft, Freunde) eine wichtige Rolle.
Ist das Erlernen eines gesunden Lebensstils vergleichbar mit dem Erlernen einer Sprache, das einem Kind viel leichter fällt als einem Erwachsenen?
Ja, in gewisser Weise schon. Je älter man ist, desto grösser ist der Aufwand, wenn man etwas Neues erlernen will. Die neuronalen Verbindungen werden zwar ein Leben lang geformt, aber die Synapsen feuern bei einem jungen Menschen einfach schneller als bei einem älteren. In den ersten sechs Jahren ist das Gehirn extrem aufnahmefähig und formbar, und zwar in die positive wie in die negative Richtung.
Was ist der Unterschied zwischen Persönlichkeit und Identität?
Unter Persönlichkeit versteht man die Art und Weise, wie ein Mensch sich habituell verhält. Dieser Habitus basiert weitgehend auf biologischen Prädispositionen und lässt sich nicht so leicht verändern. Die Identität hingegen verändert sich im Laufe des Lebens öfter. Es ist eine Art Selbstbild, das unter anderem von der sozialen und beruflichen Rolle geprägt wird. Als Jugendliche identifiziert man sich vielleicht mit Aussagen wie «Die Welt gehört mir» oder «Ich kann alles machen». In mittleren Jahren relativieren sich viele dieser Allmachtsfantasien. Die Persönlichkeit ist also der feste innere Kern eines Menschen, und die Identität ist so etwas wie eine wandelbare Hülle.
Gibt es Zusammenhänge zwischen bestimmten Persönlichkeitsstrukturen und Gesundheitsproblemen?
Ja, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und Langlebigkeit. Gewissenhaftigkeit ist einer der fünf zentralen Persönlichkeitsfaktoren, die in der Psychologie neben Neurotizismus, Extraversion, Offenheit und Verträglichkeit unterschieden werden. In vielen Langzeitstudien hat sich gezeigt, dass die Gewissenhaftigkeit eine der besten Voraussetzungen für ein langes gesundes Leben.
Streber leben also länger?
Ja, das könnte man überspitzt so sagen. Gewissenhafte Menschen putzen sich fleissig die Zähne und trinken ihre zwei Liter Wasser pro Tag. Aber Gewissenhaftigkeit bedeutet nicht nur, Befehle auszuführen und brav und gehorsam zu sein. Ein gewissenhafter Mensch ist sich seiner Werte sehr bewusst, entwickelt eigene Standards und kümmert sich um sich und andere. Diese Haltung hat viel mit Erziehung und dem Elternhaus zu tun.
Wie kann Gewissenhaftigkeit gefördert werden?
Indem wir Selbstverantwortlichkeit fördern. Wir wissen, dass Selbstverantwortlichkeit das Kernelement einer guten psychischen und physischen Befindlichkeit bis ins hohe Alter ist. Gewissenhafte Menschen fühlen sich bestimmten Werthaltungen verpflichtet und versuchen, diese möglichst auch einzuhalten. Wer Selbstverantwortung übernimmt, kümmert sich selbst um seine Gesundheit und delegiert dies nicht an jemand anderen ab oder schiebt die Schuld für Probleme auf äussere Umstände. Es gibt in jedem Leben Situationen, in denen es sehr schwierig ist, diese selbstverantwortliche Haltung aufrechtzuerhalten. Dazu gehören etwa schwierige Lebensübergänge wie Scheidungen, Kündigungen oder ein Unfall. Aber gerade in solchen Situationen ist Selbstverantwortung entscheidend, um nicht unterzugehen. Man muss aktiv werden, sich Hilfe holen und sein Leben weitergestalten.
Was muss der Staat dazu beitragen, Gewissenhaftigkeit zu fördern?
Er muss für Rahmenbedingungen sorgen, die es den Menschen auch erlauben, diese Selbstverantwortung wahrnehmen zu können. Denn wie alle Persönlichkeitsfaktoren kann diese nur in der Interaktion und nur in einer entsprechenden Umgebung zum Tragen kommen. In diesem Sinne kann der Staat die Menschen in allen Phasen des Familienlebens aktiv unterstützen. Er kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Eltern nach der Geburt ihres Kindes genügend Zeit haben, um sich um das Neugeborene zu kümmern und möglichst stressfrei in die neue Rolle hineinzufinden. Ob das nun Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Elternurlaub sein soll, soll jedes Paar selber bestimmen können.
Was kann die Arbeitswelt tun?
Die Familien müssen über die gesamte Lebensspanne und von allen Seiten gestärkt werden. Es geht nicht nur darum, dass jüngere Mütter und Väter Beruf und Familie vereinbaren können. Es geht etwa auch darum, Menschen mittleren Alters zu ermöglichen, ihren Eltern zu helfen, ohne dafür beruflich zurückstecken zu müssen. Dieses Thema muss man ernst nehmen. Gesundheitspolitik und Familienpolitik gehören zusammen. In jungen Jahren sowie im hohen Alter sind die Menschen generell verletzlich, weil sie stark von der Umwelt abhängig sind, das heisst, die Umwelt muss gut funktionieren. Das ist bekannt. Daneben haben aber auch Lebensübergänge ein hohes Verletzlichkeitsrisiko. Aber um das mittlere Lebensalter, welches gerade durch viele Übergänge gekennzeichnet ist, hat man sich jedoch bisher wenig gekümmert.
Worin besteht die Relevanz des mittleren Lebensalters für die öffentliche Gesundheit?
Wir wissen zum Beispiel, dass in der Schweiz das häufigste Scheidungsalter bei Männern bei 49 und bei Frauen bei 46 liegt und dass die Vierzig- bis Sechzigjährigen am stärksten von Burnouts betroffen sind. Das ist kein Zufall. Zwischen diesen Scheidungen und den Burnouts besteht ein Zusammenhang; Geschiedene und Getrennte leiden signifikant häufiger an Burnout als andere. Die mittleren Jahre sind in vielerlei Hinsicht kritische Jahre, aber dem wird kaum Beachtung geschenkt, weil viele dieser Probleme stark tabuisiert sind. Wer spricht schon gerne über Überforderung am Arbeitsplatz, über eine gescheiterte Beziehung oder darüber, einfach von allem genug zu haben. Viele Menschen zwischen vierzig und sechzig beklagen sich über Rollenüberdruss in Beruf und Partnerschaft – oder aber über ihre familiale Sandwichposition. Sie sind zumeist gleichzeitig verantwortlich für ihre hilfs- und pflegebedürftigen Eltern und für ihre Kinder, die heutzutage sehr lang zu Hause wohnen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die meisten Burnouts in diese Altersphase fallen. Kennzeichnend für alle sind die vielen Verantwortlichkeiten, gepaart mit extrem hohen Ansprüchen an sich und andere – und wohl auch eine falsch verstandene Gewissenhaftigkeit. Denn zur Gewissenhaftigkeit gehört eben auch die Selbstfürsorge.
Warum hat diese Lebensphase bisher so wenig Beachtung bekommen?
Früher gab es das mittlere Alter in der Wahrnehmung einfach nicht, es gab nur Jung und Alt. Durch die stark gestiegene Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten hat sich die Lebensphase zwischen diesen zwei Abschnitten aber ausgedehnt. Das mittlere Alter ist nun ein eigenständiger und entscheidender Lebensabschnitt, in dem viele Rollenveränderungen und Übergänge stattfinden, die sehr Public-Health-relevant sind.
Jean Piaget, einer der wichtigsten Entwicklungspsychologen der Schweiz im 20. Jahrhundert, hat einmal gesagt: «Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber entdecken. Aber nur, was es selber entdeckt, verbessert seine Fähigkeit, Probleme zu verstehen und zu lösen.» Kann man diese entwicklungspsychologische Tatsache auch für die gesundheitliche Entwicklung der Menschen nutzen?
In gewisser Weise schon. Hinter dieser Tatsache steckt nämlich etwas Zentrales: Wenn Kinder etwas selber erproben und die Konsequenzen ihrer Handlung erfahren, erfahren sie ihre Selbstwirksamkeit, und diese ist sehr wichtig für die Bildung von Selbstverantwortung und Gewissenhaftigkeit. Kinder und Jugendliche wollen Konsequenzen spüren, sie provozieren sie geradezu. Ein Kleinkind stösst zum Beispiel mit Genuss und Ausdauer den Klötzchenturm um, um zu sehen, wie die Steine purzeln, und Jugendliche wollen Grenzen ausloten. Es gibt heute leider die Tendenz, Kindern zu viele Erfahrungen vorzuenthalten, indem man ihnen alle Hindernisse aus dem Weg räumt oder aber sie alles machen lässt. Mit beidem tun wir den Kindern keinen Gefallen. Es würde aber zu weit gehen zu sagen, nur mit Erfahrungen könne man lernen, gesund zu leben.
Wie sehen Sie Piagets Aussage bezüglich Jugendlichen und dem Substanzkonsum: Kann zum Beispiel ein heftiger Kater eine abschreckende Wirkung für weitere Alkoholexzesse haben?
Wir brauchen nicht alle schlechten Erfahrungen selber zu machen, um gescheiter zu werden. In diesem Fall wäre eine vertrauensvolle Beziehung und Bindung zwischen Eltern und den Jugendlichen viel wichtiger und wirksamer. Ein Jugendlicher, der eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat, überlegt sich sehr gut, was er tut und ob er mit seiner Handlung seine Eltern und deren Werte vielleicht verletzen könnte. Dazu gehört natürlich ein gewisses Mass an Monitoring seitens der Eltern. Sie müssen wissen, wo ihr Kind ist und was es macht, und der Jugendliche muss wissen, dass seine Eltern ein Auge auf ihn haben und ihm aber auch vertrauen. Die Wirkung dieses Monitorings auf die Entwicklung eines gesunden Lebensstils und auf den Substanzkonsum von Jugendlichen wird unterschätzt. Es ist auch erstaunlich, wie viele Eltern keine Ahnung haben, wo ihr Kind sich in der Freizeit aufhält.
Wo liegt die Grenze zwischen einem gesunden Monitoring und kontraproduktiver Kontrolle?
Das ist die Gratwanderung zwischen Vertrauen und Kontrolle. Natürlich muss man Jugendlichen Eigenverantwortung zutrauen. Aber sie sollen ruhig auch spüren, dass die Eltern auf sie Acht geben und damit signalisieren, dass es ihnen nicht egal ist, was ihr Kind tut. Wenn die Beziehung stimmt, wird das Kind das Verhalten der Eltern auch richtig deuten, und zwar als Interesse und Sorge und nicht als Schikane.
Wie beeinflussen veränderte Familien- und Generationenbeziehungen die Lebensphasen?
Entgegen häufiger Meinung haben sich familiale Generationenbeziehungen in den letzten Jahrzehnten eher verbessert. Früher etwa wollte man so bald wie möglich ausziehen, um der Autorität der Eltern zu entfliehen. Heute leben die Kinder länger bei ihren Eltern als je zuvor, und zwar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern, weil sie sich einfach wohl fühlen. Aber auch die späteren Lebensphasen sind zumeist geprägt von gutem Zusammenhalt zwischen den Generationen (z.B. Enkelkinderbetreuung).
Wie sieht es mit der veränderten Arbeitswelt aus: Welchen Einfluss hat sie auf den Lebensverlauf?
Hier denke ich vor allem an die Frauen, die ihrem Beruf nachgehen wollen, aber eigentlich gar nie aus der Familienarbeit herauskommen. Erst sind es die Kinder, dann die Eltern und Enkelkinder, für die sie sorgen müssen, und oft tun sie alles gleichzeitig. Natürlich kommen auch immer mehr Männer in die Situation, dass sie Care-Arbeit übernehmen müssen oder wollen – sei es für ihre Kinder oder für die Eltern. Letzteres gerade auch deshalb, weil die Familien immer kleiner werden und sich die Elternpflege nur auf ein, zwei Kinder verteilt. Also sind auch Männer immer mehr auf flexible Arbeitszeiten angewiesen.
A propos Männer: Wie steht es um deren Gesundheit?
Männergesundheit ist ein grosses Thema. Suizide kommen bei Männern viel häufiger vor als bei Frauen. Männer können generell viel schlechter mit kritischen Lebensereignissen wie Verwitwung oder Scheidung umgehen als Frauen. Frauen holen sich Hilfe in schwierigen Situationen, Männer haben mehrheitlich das Gefühl, sie müssten alleine mit dem Problem fertig werden. Männer sind derzeit auch bezüglich ihrer Rolle sehr verunsichert. Einerseits gilt die Doktrin der Gleichheit der Geschlechter, das heisst, dass auch Männer zum Beispiel Familienarbeit übernehmen sollen. Andererseits hat in den letzten Jahren eine Rückwendung zu den traditionellen Geschlechterrollen und eine Erstarkung des Machismo stattgefunden. Diese Verunsicherung bezüglich Geschlechterrollen fängt schon früh an. Zum Beispiel gelten sehr viel mehr Jungen als Mädchen als verhaltensauffällig. Nun muss man aber sehen, dass die meisten Jungen bis ins Jugendalter fast nur von Frauen sozialisiert werden, also von ihren Müttern, von Erzieherinnen und Lehrerinnen. Ein Mann würde das Verhalten dieser sogenannt auffälligen Jungen vielleicht viel weniger drastisch beurteilen und nicht pathologisieren. Deshalb sollten Kinder von Anfang an möglichst von Frauen und Männern betreut und unterrichtet werden.
Die Lebensphase nach der Pensionierung dauert heute erheblich länger als noch vor ein paar Jahrzehnten. Wann und wo muss Prävention ansetzen, um die Lebensqualität nach 65 oder auch nach 80 zu erhalten?
Dazu muss man sich spätestens im mittleren Lebensalter einen Lebensstil aneignen, der auf Stimulation ausgerichtet ist, und zwar auf der kognitiven, emotionalen, sozialen und körperlichen Ebene. Das heisst, wir müssen ein Leben lang unser Gehirn beschäftigen, intime und soziale Beziehungen aufbauen und pflegen und körperlich aktiv sein. Dabei gilt: lieber früh als spät, aber auch: lieber spät als gar nicht.
Wo sind die knappen Präventionsmittel am wirksamsten investiert?
Die Kindheit ist und bleibt die entscheidende Lebensphase für die spätere Gesundheit und sollte es auch für Prävention sein. Dafür müssen wir aber nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie in den Blick nehmen. Das geht auch gar nicht anders, denn Kinder sind von ihren Eltern abhängig. Die mittleren Jahre sind relevant für das höhere Alter, weil hier die Weichen für ein gutes Alter gestellt werden. Deshalb: Wir müssen in die ersten zwei Lebensjahre investieren und damit in die jungen Familien, in gute Krippen und so weiter. Und wir müssen in die Gesundheit der Sandwichgeneration investieren.